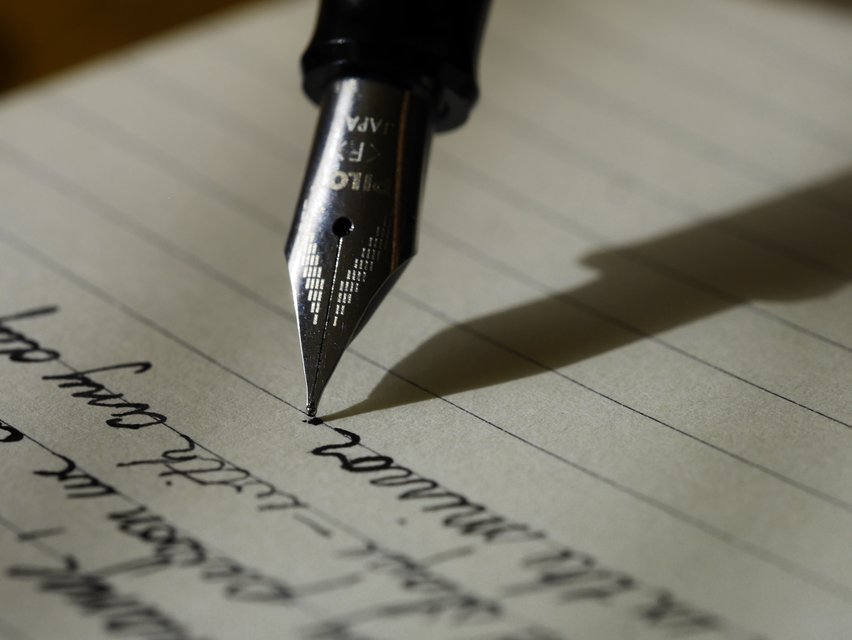Veränderungsprozesse sind in Organisationen längst keine Ausnahme mehr – sie prägen den Alltag. Für Verantwortliche im Change Management und der Kommunikation heißt das oft: Sie tragen die Verantwortung, Veränderung nicht nur anzustoßen, sondern sie anschlussfähig, verständlich und wirksam zu machen. Doch ganz gleich, wie durchdacht eine Strategie ist: Ob sie in der Organisation ankommt, entscheidet sich an einem zentralen Punkt – der Führungsebene.
Das Wichtigste in Kürze.
Führung entscheidet über Wandel: Führungskräfte übersetzen Strategie in den Alltag ihrer Teams. Ihre Haltung beeinflusst maßgeblich, ob Mitarbeitende Veränderung annehmen – besonders die mittlere Ebene braucht gezielte Unterstützung.
Aktivierung braucht mehr als Info: Neben klarer Kommunikation helfen Befähigungs- und Lernformate Führungskräften dabei, Sicherheit im Umgang mit Change, Widerstand und neuen Rollen zu erlangen.
Mitgestaltung stärkt Verantwortung: Wer als Führungskraft eigene Ideen einbringen kann, wird zur treibenden Kraft im Wandel. Partizipative Formate fördern Selbstwirksamkeit und Engagement im Change-Prozess.
Führungskräfte übersetzen Change-Vorhaben in den Alltag ihrer Teams. Sie sind nicht nur Sender von Botschaften, sondern auch Orientierungsgeber:innen und Multiplikator:innen. Ihre Haltung und ihr Verhalten prägen entscheidend, ob Mitarbeitende Vertrauen fassen, Veränderung verstehen und mitgehen. Gerade mittlere Führungsebenen stehen dabei oft im Spannungsfeld zwischen strategischem Top-down und operativer Realität.

Wenn hier Unsicherheit besteht oder sich Widerstand aufbaut, kann das den besten Change-Prozess ins Stocken bringen. Für Change- und Kommunikationsverantwortliche stellt sich daher die Frage: Wie gelingt es, Führungskräfte so zu aktivieren, dass sie nicht nur informiert sind, sondern aktiv mitgestalten und damit Veränderung möglich machen? Denn Veränderung bedeutet Umlernen.
Und Lernen ist ein individueller Prozess, der sich nicht verordnen lässt. Was es braucht, sind Rahmenbedingungen, die Resonanz ermöglichen – also Verbindungen zwischen Mensch und Organisation, zwischen Führungskraft und Team, zwischen Strategie und Alltag. Dort, wo Resonanz entsteht, erleben Menschen sich als handlungsfähig und offen für Neues.
In diesem Blogbeitrag stellen wir ein erprobtes 4-Phasen-Modell vor, das genau hier ansetzt – und eine strukturierte Hilfestellung bietet, um Führung zu aktivieren.
1. Information: Klarheit schaffen, Orientierung geben
Der erste Schritt jeder erfolgreichen Aktivierung ist die gezielte Information. Für Changemanager:innen und Kommunikationsverantwortliche heißt das: nicht möglichst viele Inhalte zu verteilen, sondern eine strategische Kommunikationsarchitektur zu entwickeln, um Fragen zu beantworten und Sicherheit zu schaffen. In dieser Phase gilt es, Führungskräfte gezielt als Schlüsselakteure zu adressieren, die Sinn vermitteln und Orientierung geben.
Die interne Kommunikation sollte daher nicht nur informieren, sondern gezielt Beziehung aufbauen – durch formatübergreifendes Storytelling, interaktive Formate und dialogische Elemente.
- Der Kontext des Wandels: Warum findet die Veränderung statt, was steht auf dem Spiel?
- Das Zielbild: Welche Vision verfolgt das Unternehmen, und was verändert sich konkre
- Die Führungsrolle: Was wird konkret von Führungskräften erwartet – kommunikativ, operativ und kulturell?
All-Hands-Meetings mit interaktiven Q&A-Formaten, Dialogformate für Führungskräfte oder Change-Storytelling in verschiedenen Formaten helfen, Informationen nicht nur zu vermitteln, sondern Verständnis zu schaffen.

2. Befähigung: Sicherheit durch Kompetenzaufbau
Information allein reicht nicht aus. Führungskräfte brauchen Raum, um sich mit der Veränderung auseinanderzusetzen – und die nötigen Kompetenzen, um ihre Rolle wirksam ausfüllen zu können. Dafür braucht es gezielte Lernräume und systematische Einbettung von Befähigungsformaten, die methodische, kommunikative und emotionale Sicherheit geben.
Effektive Formate sind:
- Microlearnings, beispielsweise in Form von Videos oder kurzen Live Sessions, zu Change-Grundlagen und Führungsverhalten im Wandel
- Kommunikationscoachings für anspruchsvolle Gespräche im Team
- Begleitangebote wie Change-Labs oder kollegiale Fallberatung
Ziel ist es, die Strategie in den Arbeitsalltag zu übertragen, einen passenden Methodenkoffer zu erarbeiten und Handlungssicherheit aufzubauen. Besonders wirksam sind Formate wie Upskilling- und Trainingsprogramme, die praxisnahe Tools und Methoden vermitteln – etwa für den Umgang mit Unsicherheit, Widerstand oder widersprüchlichen Signalen aus dem Management.
Einzelcoachings oder Peer-Sparrings können dabei individuell unterstützen.
3. Partizipation: Selbstwirksamkeit ermöglichen
Führungskräfte sind meist nicht auf Knopfdruck in der Lage, einen Change gut anzuleiten und ihre Teams zu aktivieren. Auch sie brauchen einen Sinn in ihrer Handlung und müssen den Veränderungsprozess als etwas erleben, das sie mitgestalten können. Sie nehmen verschiedene Rollen ein, müssen gleichzeitig Vorbild, Motivator:innen und Navigator:innen sein.
Das eröffnet für viele Führungskräfte Spannungsfelder und bedeutet für Kommunikationsverantwortliche: Sie müssen Formate schaffen, in denen Führung echte Gestaltungsspielräume erlebt – sei es im Austausch mit anderen, im Experimentieren oder in der co-kreativen Entwicklung eigener Maßnahmen.
Mögliche Ansätze sind:
- Aufbau eines Activation-Netzwerks, um Multiplikatoren zu gewinnen
- Working-out-Loud-Kreise zur wechselseitigen Unterstützung
- Moderierte Reflexionsformate mit Peers, um Erfahrungen zu teilen
- Selbst moderierte Workshops mit dem eigenen Team, um Orientierung zu bieten und die Selbstwirksamkeit der Führungskraft zu stärken
Entscheidend ist: Wer mitgestaltet, übernimmt Verantwortung. Und wer Verantwortung übernimmt, wird zur glaubwürdigen Kraft im Change.

4. Evaluation: Wirkung nachvollziehbar machen
Change ist kein linearer Prozess und Führungsverhalten lässt sich nicht nach Checkliste beurteilen. Dennoch ist es sinnvoll, Wirkung regelmäßig zu evaluieren. Rückmeldungen helfen nicht nur beim Nachsteuern, sondern signalisieren auch: Führung wird ernst genommen, Veränderung ist gestaltbar.
Mögliche Instrumente sind:
- Retrospektiven zu konkreten Change-Etappen
- Pulse-Checks und Sounding Board zur Wahrnehmung von Führung im Wandel
- KPI-basierte Indikatoren, z. B. Beteiligungsraten, Rücklaufquoten, Kommunikationsreichweiten
Evaluation schafft außerdem Transparenz: Sie zeigt, dass Führungskommunikation keine Einbahnstraße ist, sondern ernst genommen und weiterentwickelt wird.
Fazit
Führung braucht gezielte Aktivierung – nicht mehr Information
Wer seine Führungskräfte im Wandel wirksam einbinden will, muss sie ernst nehmen – als Adressat, als Partner und Partnerinnen, als aktive Kraft. Es braucht ein durchdachtes Aktivierungsdesign wie den 4-Phasen-Ansatz für eine klare Struktur: informieren, befähigen, beteiligen, evaluieren.
Ergänzt durch eine realistische Standortbestimmung entsteht so ein Aktivierungsdesign, das nicht auf Reaktion setzt, sondern auf gezielte Entwicklung. Denn Veränderung bedeutet gemeinsames Lernen – und gelingt dann, wenn Führungskräfte in resonante Beziehungen eingebunden sind, die sie befähigen, beteiligen und begleiten.
Und jetzt?
Du möchtest Führungskräfte in deinem Change-Projekt gezielt aktivieren? Dann sprich uns an – wir unterstützen dich mit konkreten Maßnahmen, Trainingsprogrammen, Workshops und sparringstauglichen Konzepten.
Du willst wissen, welche Kompetenzen Führungskräfte für Veränderung brauchen? Dann lade dir kostenfrei unsere Wissenskarten „Methodenwerkstatt Future Skills“ herunter – kompakt, praxisnah und direkt einsetzbar.